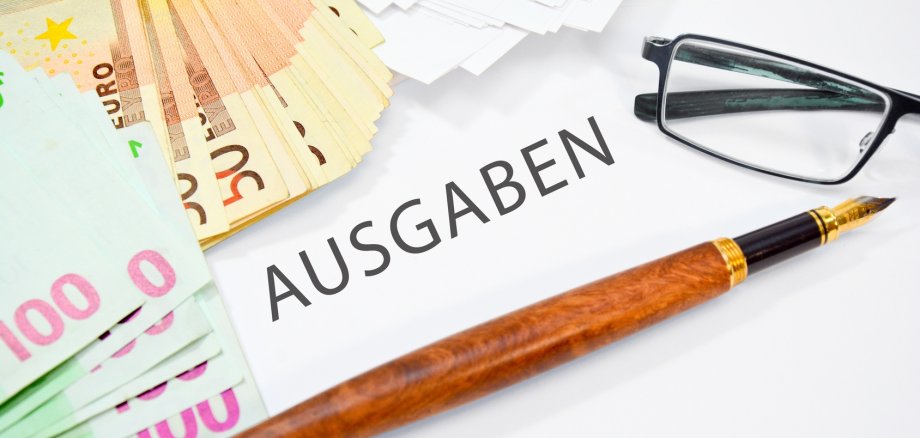Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beobachtet mit Sorge die aktuelle Sozialstaatsdebatte. Die Politik scheint wieder in den Fehler zu verfallen, zur Beseitigung vermeintlicher sozialer Ungleichheiten Transferleistungen und das Sozialbudget zu erhöhen, ohne vorher die Effizienz der bestehenden Systeme zu überprüfen.
Deutschland wird auf Dauer keine Wohlstandsinsel in einer immer schwierigeren Welt sein können. Deshalb sollte die Politik nicht immer mehr neue und bessere Leistungen versprechen in dem Irrglauben, das sei der entscheidende Faktor, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das Gegenteil ist richtig: Wir müssen die Eigenverantwortung stärken, Eigenvorsorge fördern und den Weg vom Vater Staat zum Bürgerstaat einschlagen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass auch die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates natürliche Grenzen hat und der Staat nur verteilen kann, was zuvor erwirtschaftet wurde.
Tatsache ist, dass die Kosten für soziale Leistungen in Deutschland immer weiter steigen, ohne dass auf den ersten Blick erkennbar ist, wofür und mit welchen Erfolgen diese finanziellen Mittel verwendet werden. Die große Anzahl verschiedener Leistungen, oftmals mangelnde Transparenz beim Einsatz der Mittel und die nur schwer messbaren Wirkungen gefährden die Akzeptanz des Sozialsystems.
Der Anstieg der kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen ist weiterhin ungebrochen. 2015 wurde mit 52 Mrd. Euro erstmals die 50-Milliarden-Grenze überschritten. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Der Bund hat mit der Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2014 einen Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation geleistet. Das allein reicht aber nicht. Allein die Verschiebung der Kosten zwischen den föderalen Ebenen macht den Sozialstaat nicht zukunftsfest.
Der große Strauß sozialer Leistungen muss neu geordnet, auf die wirklich Bedürftigen konzentriert, entbürokratisiert und transparent gestaltet werden. So gibt es zum Beispiel rund 150 familienpolitische Leistungen in unterschiedlicher Höhe und Zielrichtung mit einem Gesamtvolumen von 129 Mrd. Euro pro Jahr. Gutachten zur Wirkungsweise dieser Leistungen kamen zu dem Ergebnis, dass die Leistungen teilweise nicht zusammen passen oder sich gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben. Bis heute wurden aus den Ergebnissen keine Konsequenzen gezogen. Auch bei der Hilfe für Menschen, die ihren Wohnraum nicht angemessen finanzieren können, gibt es einerseits die Unterkunftskosten, die Kommunen und Bund finanzieren, und andererseits das Wohngeld, welches nach anderen Kriterien bewilligt und von Bund und Ländern finanziert wird.
Wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen dort ansetzen, wo Hilfe wirklich benötigt wird. Das deutsche Sozialsystem ist über Jahrzehnte langsam gewachsen und schließlich gewuchert. Es orientiert sich zu wenig an den praktischen Bedürfnissen und unterstützt in einigen Bereichen eher diejenigen, die sich gut auskennen, als diejenigen, die Hilfe tatsächlich benötigen.
Der DStGB fordert schon seit längerem eine unabhängige Sachverständigenkommission zur Reform der sozialen Leistungen einzusetzen. Wegen der Vielzahl der Beteiligten, der Einbindung aller staatlichen Ebenen, ist eine grundlegende und neutrale Vorbereitung rechtzeitig vor der nächsten Legislaturperiode unverzichtbar. Vorbilder sind insoweit die Kommissionen zur Vorbereitung der Arbeitsmarktreformen und zur Novellierung des Zuwanderungsrechts. So, wie Deutschland durch die Arbeitsmarktreformen seine Wettbewerbsfähigkeit vehement gesteigert hat, kann auch eine solche Sozialstaatsreform Vorbild für ein europäisches Modell des Sozialstaates werden.
Aus Sicht des DStGB muss das Reformwerk einen wichtigen Beitrag leisten, so dass die Eigenverantwortung und Eigenvorsorge gestärkt werden und dass es einen Vorrang für Investitionen, zum Beispiel in Bildung, vor höheren Transferleistungen gibt. Auch ausländische Erfolgsmodelle sollten hier berücksichtigt und gewichtet werden.
Bund, Länder und Kommunen sind in Deutschland mit über zwei Billionen Euro verschuldet. Täglich müssen dafür weit über 100 Millionen Euro Zinsen aufgebracht werden. Die Schuldenlast der Kommunen ist auf 145 Mrd. Euro angewachsen, die Kassenkredite sind mit rund 52 Mrd. Euro auf einem Rekordhoch.
Viele Kommunen haben kaum noch Gestaltungsspielräume, um z. B. mehr in Bildung, Kindertageseinrichtungen, Kultur und Sport oder die sonstige Infrastruktur zu investieren, obwohl gerade dies die Bürgerinnen und Bürger von ihren Städten und Gemeinden erwarten. Insgesamt geht die Schere zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen immer weiter auseinander.
Die freiwilligen Aufgaben werden zunehmend in Frage gestellt. Damit ist nicht nur die kommunale Selbstverwaltung, sondern auch die lokale Demokratie gefährdet. Sie ist die Basis unseres Staates. Bürgerinnen und Bürger begegnen dem Staat in erster Linie in ihrer Stadt und Gemeinde.
Wenn dort nicht mehr ansatzweise das Notwendigste geleistet werden kann, wird die Politikverdrossenheit weiter steigen, die Partizipation und die Bereitschaft, sich für die Allgemeinheit einzusetzen, sinken. Die Politik muss die Wende herbeiführen. Wir brauchen eine Agenda 2030, mit der die notwendigen Reformen und die Neuausrichtung unserer Gesellschaft eingeleitet werden.
(Statement von Dr. Gerd Landsberg, DStGB, 24.03.2016)
Weitere Informationen:
(Foto: © Marco2811 - Fotolia.com)